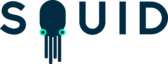Berlin (Reuters) – Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) dringt auf eine Aufholjagd Deutschlands und Europas in der Raumfahrt.
“Raumfahrt ist in einer geopolitisch unsicheren Welt weit mehr als Technologie – sie ist notwendige sicherheitsrelevante Infrastruktur. Wer keine eigenen Weltraumfähigkeiten besitzt, ist abhängig und verwundbar”, betonte BDI-Präsident Peter Leibinger am Donnerstag vor dem Weltraumkongress des Verbandes in Berlin.
Laut einer vom BDI in Auftrag gegebenen Studie der Unternehmensberatung Roland Berger “Aufholjagd im All” ist der Rückstand mittlerweile sehr groß. Deutschland betreibe derzeit nur etwas mehr als 80 eigene Satelliten, die USA dagegen mehr als 10.000 und China mehr als 900. Bei beiden Ländern sei die Tendenz stark steigend. Dadurch entstünden problematische Abhängigkeiten, etwa bei der Satellitenkommunikation. Dabei seien Satelliten heute für die Volkswirtschaften, Logistik, Mobilität und die Verteidigungsfähigkeit entscheidend. Der globale Markt für weltraumgestützte Infrastruktur und Dienste wird sich laut Roland-Berger-Studie bis 2040 vervierfachen, auf ein Volumen von zwei Billionen Euro. Um den aktuellen europäischen Marktanteil von rund 17 Prozent im wachsenden Weltraum-Markt zu halten, wären bis 2040 zusätzliche Investitionen in Höhe von etwa 237 Milliarden Euro notwendig.
Der BDI fordert deshalb nicht nur, dass das Bewusstsein für die Bedeutung von Raumfahrt in Deutschland deutlich wachsen müsse. Die Industrie brauche zudem Staatsaufträge und Investitionen. Zudem wird eine engere Kooperation nationaler und europäischer Raumfahrtbehörden gefordert, um die Kräfte zu bündeln. Damit die sogenannte NewSpace-Economy, also Start-ups und Mittelständler, in dem Bereich wachsen könnten, müssten zudem bürokratische Vorgaben abgebaut werden.
Die EU plant den Aufbau eines eigenen Netzes von Kommunikationssatelliten, zusammen mit einem Konsortium mehrerer privater Firmen, darunter die Deutsche Telekom und der französische Satellitenbetreiber Eutelsat. Im Rahmen des Projekts namens Iris sollen 290 Satelliten in niedrigen und mittleren Umlaufbahnen platziert werden, um Internet- und Mobilfunkverbindungen zu ermöglichen. Allerdings wird das Satellitennetz nicht vor 2030 einsatzbereit sein.
(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)