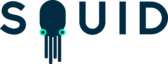Tokio (Reuters) – In Japan steigt die konservative Politikerin Sanae Takaichi zur ersten Ministerpräsidentin des Landes auf.
Die 64-Jährige wurde am Dienstag von beiden Kammern des Parlaments zur neuen Regierungschefin gewählt. Mit der Vorsitzenden der seit langem regierenden LDP-Partei gibt es in der japanischen Politik einen deutlichen Rechtsruck. Takaichi kommt aus dem politischen Lager des 2022 nach einem Attentat verstorbenen Ex-Ministerpräsidenten Shinzo Abe und dürfte im Stil der “Abenomics”-Konjunkturpolitik die japanische Wirtschaft anschieben wollen. Ob ihr dies gelingt, obwohl ihre Koalition keine Mehrheit hat, ist unklar. Takaichi berief mit der 66-jährigen Satsuki Katayama die erste Frau an die Spitze des Finanzministeriums.
Am Montag hatte Takaichi eine Koalitionsvereinbarung mit der bisher oppositionellen rechten Ishin-Partei unterzeichnet und sich so die Wahl im Parlament gesichert. Der frühere Koalitionspartner der LDP, die gemäßigtere Komeito-Partei, hatte die 26 Jahre bestehende Allianz aufgekündigt, als die LDP die rechtsgerichtete Takaichi zu ihrer neuen Vorsitzenden machte.
Die ehemalige Innenministerin folgt als Regierungschefin ihrem LDP-Parteifreund Shigeru Ishiba, der im September nach einer Reihe von Wahlniederlagen zurückgetreten war. In der Bevölkerung wuchs unter anderem der Unmut über gestiegene Lebenshaltungskosten. Takaichi gilt als Befürworterin einer lockeren Fiskalpolitik. Sie hat Steuersenkungen und höhere Staatsausgaben gefordert, um die Japaner zu entlasten.
FINANZMINISTERIN LEGT FOKUS AUF WÄHRUNGSPOLITIK
Die ebenfalls als Vertraute Abes geltende Katayama äußerte sich unmittelbar nach ihrer Ernennung zur Finanzministerin zur Währungs-, aber nicht nur Geldpolitik. Vor der Presse sagte die langjährige Abgeordnete und ehemalige Mitarbeiterin des Finanzministeriums, es sei wünschenswert, dass sich die Wechselkurse stabil und im Einklang mit den Fundamentaldaten bewegten. Fragen zur Bank of Japan beantwortete sie nicht.
Takaichi übernimmt die Führung der Regierung in Tokio zu einer Zeit, in der die japanische Politik so zersplittert erscheint wie seit langem nicht mehr. Dies liegt nicht zuletzt am Aufstieg der kleineren Rechtsaußen-Partei Sanseito, die der Regierungspartei LDP Wählerschaft abgejagt hat. Im Rennen um den LDP-Vorsitz hatte Takaichi mit höheren Rüstungsausgaben und mehr Bemühungen um die nationale Sicherheit geworben. Die Kooperation mit den verbündeten USA will sie ausbauen.
ABKEHR VON PAZIFISMUS-VERFASSUNG – HARTER EINWANDERUNGSKURS
Takaichi befürwortet eine Änderung der pazifistischen Nachkriegsverfassung Japans, um der wachsenden Bedeutung des Militärs Rechnung zu tragen. Die LDP-Chefin besucht regelmäßig den umstrittenen Yasukuni-Schrein, in dem der japanischen Kriegstoten gedacht wird – darunter sind auch hingerichtete Kriegsverbrecher. Der Schrein wird daher in einigen Nachbarstaaten als Symbol für den früheren Militarismus des Landes angesehen. Takaichi schlägt auch in der Einwanderungspolitik einen schärferen Ton an.
Takaichis Aufstieg zur ersten Frau an der Spitze einer japanischen Regierung gilt zwar als Durchbruch in einem Land, in dem die Politik nach wie vor stark von Männern dominiert wird. Doch die Konservative, die Großbritanniens ehemalige Premierministerin Margaret Thatcher bewundern soll, zeigt sich als Verfechterin traditioneller Werte. So will sie es verheirateten Frauen verbieten, ihren Mädchennamen zu behalten.
Takaichi berief zudem neben Finanzministerin Katayama nur noch eine weitere Frau in ihr Kabinett; Kimi Onoda wird Ministerin für wirtschaftliche Sicherheit. Im Wahlkampf hatte Takaichi noch mehr versprochen: Sie wollte den Frauenanteil im Kabinett erhöhen, um mit skandinavischen Ländern gleichzuziehen. Dort reicht der Anteil der Ministerinnen von 36 Prozent in Dänemark bis zu 61 Prozent in Finnland. Unter Takaichi liegt der Frauenanteil im japanischen Kabinett, sie selbst eingeschlossen, bei 16 Prozent.
(Bericht von Mariko Katsumura, Tim Kelly, Leika Kihara und Makiko Yamazaki; geschrieben von Elke Ahlswede; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)