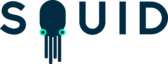Berlin (Reuters) – Nach zwei Rezessionsjahren in Folge kann die deutsche Wirtschaft nicht mit einem Durchstarten des Konjunkturmotors rechnen.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte 2025 nur um 0,3 Prozent zulegen, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag in ihrer aktualisierten Prognose mitteilte. Für 2026 wird ein Plus von 1,1 Prozent veranschlagt. Damit setzte die OECD die BIP-Prognosen gegenüber dem Ausblick vom Juni um je 0,1 Prozentpunkte nach unten.
IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller, dessen Institut an der am Donnerstag anstehenden Gemeinschaftsdiagnose (GD) für die Bundesregierung beteiligt ist, äußerte sich skeptisch: “Wir haben keinen normalen Aufschwung vor uns. Wir krebsen uns von unten an ein immer schwächer werdendes Produktionspotenzial heran.” Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner sei fast drei Prozent niedriger als 2019, sagte der Ökonom aus Halle bei einer von der OECD organisierten Diskussionsrunde.
Holtemöller kündigte an, dass die führenden Institute bei der Vorstellung der Gemeinschaftsdiagnose einen Zwölf-Punkte-Plan zu Strukturreformen vorlegen werden. Die GD liefert eine Orientierung für die Projektionen der Bundesregierung. Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft IW, Michael Hüther, sprach mit Blick auf die wirtschaftliche Verfassung von “einer Art ‘Germanosklerose’: Deutschland stecke in einer Wachstumskrise, die strukturelle Gründe habe. Das über Jahre erfolgreiche Geschäftsmodell stehe unter Druck: Der Export leide unter Deglobalisierungs- und Protektionismustendenzen. Die Investitionen kämen nicht in Gang und die Konsumenten hätten angesichts steigender Arbeitslosenzahlen Sorgen um ihre Beschäftigungssicherheit. “Das alles ist ein Strukturthema und da wird uns auch ein kurzes Konjunkturfeuerwerk nicht helfen”, fügte er hinzu. Auch das von der OECD veranschlagte Wachstum von 1,1 Prozent für 2026 biete “keine Aufholqualität”.
“STRUKTURPROBLEM UNABWEISBAR”
“Wir haben sicherlich konjunkturelle Schwächephasen hinter uns. Aber wir haben auch ein Strukturproblem, das unabweisbar ist”, konstatierte der Leiter des Bundesbank-Zentralbereichs Volkswirtschaft, Jens Ulbrich. Das sei auch am Potenzialwachstum abzulesen. Darunter verstehen Ökonomen die langfristige BIP-Veränderung bei normaler Auslastung der Produktionskapazität. “Da liegen wir im Moment bei 0,4 Prozent, ohne aus heutiger Sicht große Aussicht, dass sich dies mit der gegenwärtigen Politik verändern wird”, sagte Ulbrich. Es gehe letztlich darum, das Potenzialwachstum zu heben und beispielsweise Spielräume bei der Erwerbstätigkeit von Frauen zu nutzen. Außerdem müsse das Land als Migrationsstandort attraktiver werden. “Und dann werden wir am Ende angesichts der demografischen Entwicklung auch nicht umhinkommen, uns über das Renteneintrittsalter zu unterhalten”, mahnte der Bundesbank-Ökonom.
Ulbrich erwartet nicht, dass dieses Jahr bereits Konjunkturimpulse aus dem Fiskalpaket entstehen: “Das dauert ein bisschen, um die auf die Straße zu bringen.” Nach einem womöglich leichten Wachstum im laufenden Jahr werde es 2026 wahrscheinlich besser laufen: Dabei richteten sich die Hoffnungen auf das Fiskalpaket, aber auch auf eine Belebung am Bau und ein Anziehen der Investitionen. Der Konsum werde mit dem verfügbaren Einkommen wachsen.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat für das Jahr 2026 Rekordinvestitionen von 126,7 Milliarden Euro angekündigt. Damit wolle die Regierung für mehr Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und sichere Arbeitsplätze sorgen, sagte der SPD-Chef bei der Einbringung seines Entwurfs für den Bundeshaushalt 2026 in den Bundestag. Er sprach mit Blick auf die hohe Verschuldung für Investitionen von einem “finanzpolitischen Paradigmenwechsel”, der international positiv wahrgenommen werde. Mit dem Geld solle saniert werden, was “jahrelang vernachlässigt wurde”, vor allem die Infrastruktur.
(Bericht von Reinhard Becker; Mitarbeit Christian Krämer; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)