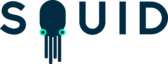Washington (Reuters) -Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr deutlich stärker gewachsen als gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni aufs Jahr hochgerechnet um 3,8 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. In einer vorläufigen Schätzzahl war nur von 3,3 Prozent die Rede. Der Anstieg des BIP im zweiten Quartal war laut dem Ministerium vor allem auf einen Rückgang der Importe zurückzuführen sowie auf einen Anstieg der Verbraucherausgaben. Zugleich seien Investitionen und Exporte zurückgegangen.
Im ersten Quartal war die Wirtschaft um abwärts revidiert 0,6 Prozent geschrumpft. Dies war auf Vorzieheffekte zurückzuführen, da viele Importeure die Zeit vor dem von US-Präsident Donald Trump im April ausgelösten Zollstreit genutzt hatten, um verstärkt Waren in die Vereinigten Staaten einzuführen.
Im Frühjahr kam es zwar wieder zu Wachstum. Doch US-Notenbankchef Jerome Powell verwies jüngst darauf, dass das BIP im ersten Halbjahr nicht mehr so stark zugelegt habe wie im Vorjahr. Die Wachstumsabschwächung sei größtenteils auf eine Verlangsamung der Konsumausgaben zurückzuführen. Auch der Arbeitsmarkt zeigte zuletzt Anzeichen der Schwäche, was die Notenbank mit dazu bewegte, erstmals in diesem Jahr die Zinszügel zu lockern.
Der Schlüsselsatz liegt seither im Bereich von 4,00 bis 4,25 Prozent. Die Währungshüter waren sich im Zinsausblick über die Notwendigkeit weiterer Senkungen in diesem Jahr allerdings uneinig. Während die mittlere Prognose von zwei weiteren Senkungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt bis Ende 2025 ausgeht, halten sieben Währungshüter weitere Zinssenkungen für nicht angebracht.
Notenbankchef Jerome Powell ließ die Finanzmärkte jüngst weiter im Unklaren, wie es mit dem Zinskurs weitergeht. US-Notenbankdirektor Stephen Miran stellte sich unterdessen hinter die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach kräftigen Zinssenkungen. Der jüngst von seinem Job als Wirtschaftsberater im Weißen Haus in die Notenbank gewechselte Vertraute Trumps sagte dem Sender Fox Business, der Leitzins sollte in großen Schritten um insgesamt zwei Prozentpunkte gesenkt werden. Er begründete diese Ansicht damit, dass die Wirtschaft “bei einer derart restriktiven Geldpolitik” anfälliger für negative Schocks werde. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Zölle die Inflation antrieben. Zugleich räumte er ein: “Aber das ist es, was viele meiner Kollegen zurückhält.”
(Bericht von Büro Washington, Howard Schneider, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)