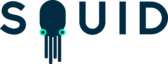Berlin (Reuters) – Trotz Anschubhilfe durch das milliardenschwere Fiskalpaket zeichnet sich laut den Wirtschaftsweisen kein nachhaltiger Aufschwung ab.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte 2026 nur um 0,9 Prozent steigen, wie die fünf Top-Ökonomen am Mittwoch im Jahresgutachten für die Bundesregierung mitteilten. Sie sind damit pessimistischer als die führenden Forschungsinstitute, die ein Plus von 1,3 Prozent veranschlagen. Für 2025 erwarten die Wirtschaftsweisen nur ein kleines Plus von 0,2 Prozent. “Das Wachstum ist schwach und das Sondervermögen wird trotzdem nicht hinreichend für wachstumsfördernde Investitionen verwandt”, monierte die Ökonomin Ulrike Malmendier vor der Presse. Die Regierungsberater mahnten, die mit dem milliardenschweren Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität verbundenen Chancen für das Wachstum nicht zu verspielen.
Sie kritisieren einen Verschiebebahnhof der Regierung bei den Ausgaben: “Die Mittel des Sondervermögens sollten nicht an die Stelle bestehender Haushaltsmittel treten, sondern die Investitionen über das bisherige Niveau hinaus erhöhen”, forderten die Wissenschaftler um die Münchner Ökonomin Monika Schnitzer.
Der Wirtschaftsweise Martin Werding sagte, es sei erkennbar, dass ein Gutteil des Sondervermögens nicht in zusätzliche Ausgaben mit starkem Investitionscharakter fließen dürfte. Stattdessen würden Finanzierungslücken in den alten Haushaltsplanungen gefüllt. Geplante Ausgaben würden in das Sondervermögen verschoben, sodass im Kernhaushalt Platz für rein konsumtive Ausgaben geschaffen werde.
Das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) in Höhe von 500 Milliarden Euro soll bis zum Jahr 2037 staatliche Investitionsrückstände bei der Infrastruktur abbauen, zum Erreichen der Klimaneutralität beitragen und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beleben. Zugleich legt das Grundgesetz ausdrücklich fest, dass es vom Bund nur zu zusätzlichen Investitionen eingesetzt werden darf. Bereits im Bundeshaushalt 2025 und im Entwurf für den Etat 2026 wird dieses Prinzip laut den Ökonomen jedoch unterlaufen.
“HIER MUSS NACHGESTEUERT WERDEN”
Sie schätzen, dass nach den bisherigen Plänen bis 2030 weniger als die Hälfte der dann verausgabten Gelder des Sondervermögens in zusätzliche Mittel fließen. Bei einer zielgerechten Verwendung sei “eine Anhebung des BIP-Wachstumspfads” von bis zu fünf Prozent bis 2030 erreichbar. Wenn die Planungen Realität werden sollten, würden es jedoch weniger als zwei Prozent. “Hier muss nachgesteuert werden”, forderte Werding. Es brauche klarere Regeln für Zusätzlichkeit und Zielgenauigkeit. Das SVIK sollte nach Ansicht der Wissenschaftler außerdem nicht herangezogen werden, um im Kernhaushalt Spielraum zur Finanzierung “fragwürdiger Maßnahmen” wie der Ausweitung der Mütterrente oder der Anhebung der Pendlerpauschale zu schaffen.
Die Ökonomen plädieren zugleich für eine Reform der Erbschaftsteuer. Ziel sollte es sein, die Vermögensungleichheit in Deutschland zu reduzieren und dafür Unternehmen sowie Reiche stärker in die Pflicht zu nehmen. Der Wirtschaftsweise Achim Truger sagte, Betriebsvermögen würden stark geschützt. Im Ergebnis würden dadurch ausgerechnet sehr hohe Erbschaften oder Schenkungen nur sehr gering besteuert. Bei Betriebsvermögen unter 26 Millionen Euro sollte der sogenannte Verschonungsabschlag erheblich reduziert werden. Oberhalb von 26 Millionen Euro sollte es keine Schonung mehr geben oder diese zumindest stark eingeschränkt werden. Sie ist eigentlich gedacht, damit Unternehmen Jobs langfristig erhalten. Damit es keine Liquiditätsprobleme für Firmen gebe, sei eine großzügige Stundung der Steuerlast denkbar. Statt Freibeträgen alle zehn Jahre könnte ein Freibetrag für das gesamte Leben eingeführt werden.
Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht die Vorschläge ihrer Kollegen allerdings kritisch: Eine höhere Steuerbelastung anlässlich von Unternehmensübertragungen könnte ihrer Ansicht nach durchaus mit erheblichen Risiken geringerer Investitionen verbunden sein. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte, im Rahmen einer gerechten Erbschaftsteuerreform müssten die Sonderregelungen für reiche Unternehmenserben endlich fallen: “Wer Hunderte von Millionen erbt, sollte angesichts der von den Wirtschaftsweisen beklagten extremen Vermögensungleichheit auch einen gerechten Beitrag zum Gemeinwesen leisten.”
(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Andreas Rinke, Rene Wagner, Klaus Lauer, Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)